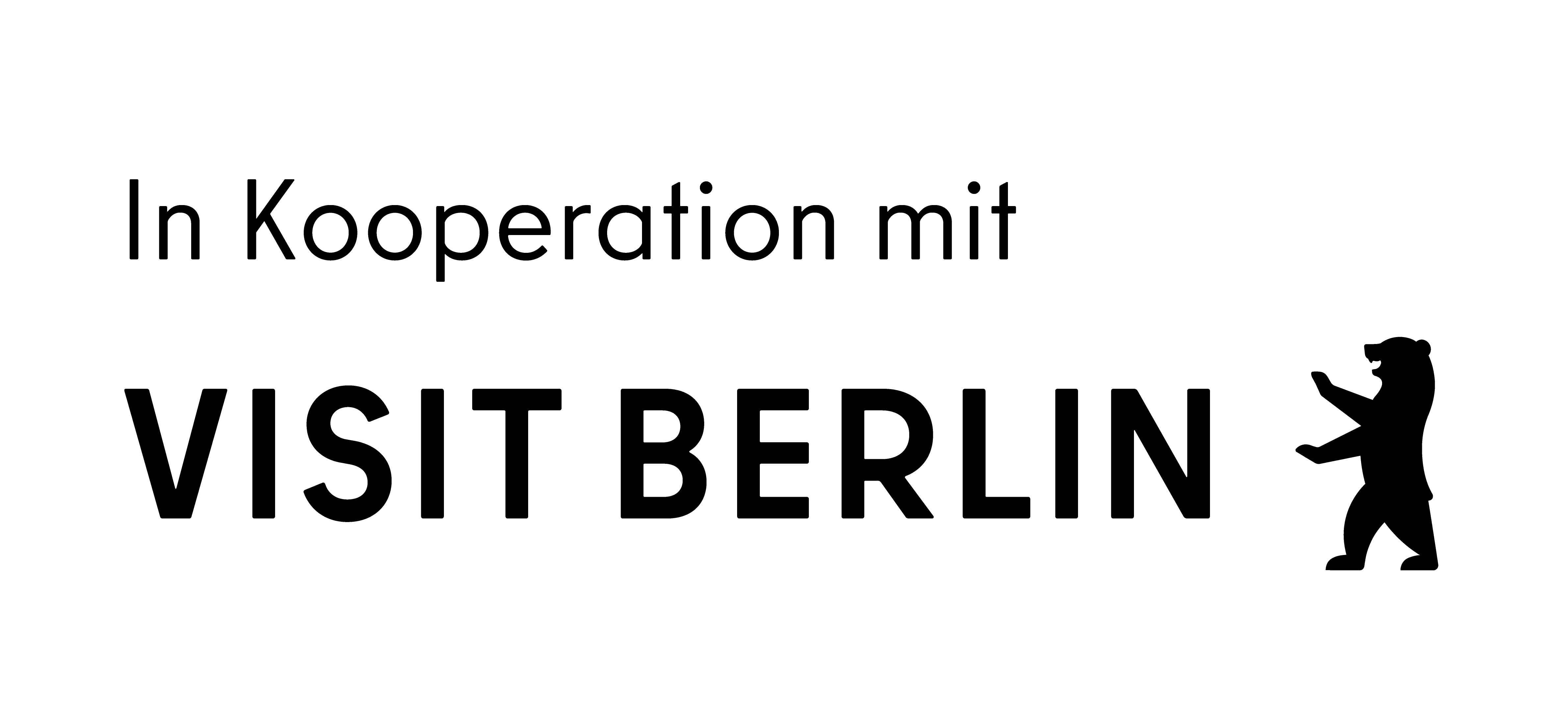Audiowalk "and let no one be forgotten"

Foto: Katya Romanova
S-Bahn Karlshorst
Bäckerei an der S-Bahn Karlshorst
und
Der Weg zum Odesaplatz
Der Audiowalk beginnt vor der Bäckerei Feihl an der S-Bahnstation Karlshorst und führt von hier zum Odesaplatz, es unterhalten sich Caro und Marianne, unter anderem über Bienenstich, ihren Lieblingskuchen zu DDR-Zeiten.
Ort: Bäckerei an der S-Bahn Karlshorst
CARO:
Ich frage mich, ob sich viel verändert hat, oder ob du dich genauso fühlst, wenn du wieder hier bist.
MARIANNE:
Ja, ich bin neugierig, es nach all der Zeit wieder zu sehen.
CARO:
Ich möchte, dass du mir beschreibst, wie deine Kindheit hier war. Wie war das so?
MARIANNE:
Oh, ich weiß es nicht. Wo soll ich überhaupt anfangen? Nun ja... Bäckereien wie diese gab es damals noch nicht wirklich. Nicht hier. Und Kaffee trinken zu gehen, war auch noch nicht so eine Sache.
CARO:
Karlshorst war wohl nicht gerade auf dem neuesten Stand der Dinge, oder?
MARIANNE:
Das kann man wohl sagen.
CARO:
Also... die Leute haben einfach ihr eigenes Brot gebacken?
MARIANNE:
Ah nein, wir hatten zwar Bäckereien, aber das waren eben nur Bäckereien. Man konnte nicht einfach in ihnen sitzen, so wie wir jetzt. Ich erinnere mich, dass wir als Kinder zum Bäcker gegangen sind, und weil die Kuchen auf großen Blechen gebacken wurden, haben sie die Ränder abgeschnitten. Für 20 Pfennig oder so konnte man eine kleine Tüte mit Kuchenrändern bekommen.
CARO:
Ich wünschte, sie würden das heute noch machen. Ich würde ein paar billige Kuchenreste nehmen.
MARIANNE:
Die Kuchensorten in den Tüten waren zufällig, aber ich habe immer alle Stücke von meinem Lieblingskuchen aufgehoben.
CARO:
Bienenstich?
MARIANNE:
Ja, Bienenstich! Ich habe sie bis zum Schluss aufgehoben.
CARO:
Hat es dir gefallen, hier aufzuwachsen?
MARIANNE:
Ich habe es geliebt.
CARO:
Was hat dir denn gefallen?
MARIANNE:
Damals war es wie ein kleines Dorf. Die Welt fühlte sich kleiner an. Wir passten aufeinander auf. Und es war langsamer. Nicht dieses „los los los“ von heute. Die Leute blieben auf der Straße stehen, um zu reden... Es war eine Gemeinschaft. Wir hatten Gemeinschaft.
Ich erinnere mich, dass es immer noch Männer gab, die mit Eisblöcken vorbeikamen. Sie trugen die Blöcke auf einem Gestell auf der Schulter, hackten sie mit Eispickeln an und brachten sie in die Häuser für die alten Eiskästen.
CARO:
Das klingt wie aus einem Film.
MARIANNE:
Ja (sie kichert). Und jeden Mittwoch um 6 Uhr läutete einer von ihnen eine Glocke und rief: „Brennholz für Kartoffelschalen, Brennholz für Kartoffelschalen!“ Und wir rannten alle nach oben, schnappten uns die Schüssel - es gab eine spezielle braune Schüssel mit einem Loch darin, in der wir die ganze Woche über die Kartoffelschalen aufbewahrten - und brachten sie zu ihm herunter. Er wog die Kartoffelschalen ab und gab uns im Gegenzug genauso viel feines Anzündholz. Das war wichtig für das Anzünden des Badeofens. Daran erinnere ich mich noch genau!
Und in der Gundelfingerstraße gab es - auch wenn es heute keiner mehr glaubt, aber ich schwöre es - andere erinnern sich auch. Im vorderen Teil der Gundelfingerstraße gab es eine Kuh, die in einem Hof gehalten wurde - sie wurde jeden Tag gemolken. Und im Hof nebenan gab es noch einen Schmied, nicht für Gold, sondern zum Beschlagen von Pferden. Wir schauten aus respektvollem Abstand zu, völlig fasziniert.
Irgendwie schien es einfach und leicht zu sein.
CARO:
Einfach?
Ort: Der Weg zum Odesaplatz
Jeremy Knowles:
„Das große Spiel ist fast vorbei.“
So endete ein Artikel über den russischen Rückzug aus Karlshorst im Guardian am 11. Februar 1994.
Damals sagte General Matvei Burlakov, der Leiter der russischen Streitkräfte in Berlin, der Presse, dass
keine russische „Kugel, Granate oder Mine auf deutschem Boden zurückbleiben“ würde.
Über 30 Jahre später ist die russische Munition vielleicht weg, aber andere Relikte sind noch da.
Willkommen bei „And Let No One Be Forgotten“ – ein Audiowalk durch Karlshorst, der die besondere Geschichte einiger Häuser erzählt, die seit 1994 leer stehen und fast unberührt sind.
Diese Geschichte handelt nicht nur von den Häusern, sondern auch von den Menschen, die mit ihnen in Kontakt kamen, direkt oder indirekt. Es ist eine Geschichte darüber, was (und wer) zurückbleibt, wenn Imperien fallen.
Mein Name ist Jeremy Knowles und bin einer der drei Künstler*innen, die diesen Audiowalk erstellt haben. Wir kommen aus drei der vier Alliierten-Nationen, die 1945 die deutsche Kapitulationsurkunde unterzeichneten und damit den Zweiten Weltkrieg beendeten. Auch wenn wir keine Deutschen und nicht in Karlshorst aufgewachsen sind, ist auch unsere Geschichte mit diesem Ort verbunden. Unser Leben wurde von den Ereignissen beeinflusst, die hier stattfanden.
Die Inspiration für dieses Projekt kam mir, als ich 2023 einen Spaziergang durch Karlshorst machte. Ich kam zum ersten Mal an den Häusern in der Andernacherstraße und Königswinterstraße vorbei und stand fassungslos vor ihrer Leere - Ihrer Ruhe - Ihrer Stille.
Ich fragte mich, wie sich die Menschen, die jetzt in der Nähe der Häuser wohnen, wohl fühlen und was sie von dieser Geschichte halten.
Ich fragte mich, wie es sich wohl anfühlt, so nah an diesen zerfallenen und scheinbar vergessenen Denkmälern der sowjetischen Besatzung Ostberlins zu leben. Fühlt sich diese rasante Zeit der deutschen Geschichte drei Jahrzehnte später in Karlshorst noch präsent an?
Es ist „alles eine Frage des Erinnerns und Vergessens“, schrieb der Autor des Guardian-Artikels.
…Erinnerung.
…und das Vergessen.
Es scheint, dass die Ostdeutschen sich damals schon bewusst waren, wie schwer es war, ein Kapitel der Geschichte zu beenden
und gleichzeitig die Gegenwart zu dokumentieren – eine Gegenwart, die Francis Fukuyama als “das Ende der Geschichte” bezeichnete.
Wir machen einen gemeinsamen Spaziergang.
Dreh dich mit dem Rücken zum Bahnhof. Du solltest nun gegenüber der Havanna Bar stehen. Folge der Treskowallee nach Norden bis zum Odesa-Platz. Es sind nur etwa zwei Minuten zu Fuß, aber lass dir Zeit. Wir haben es nicht eilig.
Als ich über Karlshorsts sowjetische Vergangenheit, über Erinnerung, Teilung und Identität nachdachte, erinnerte ich mich an den Science-Fiction-Roman „Picknick am Wegesrand“ von den Brüdern Strugatsky aus dem Jahr 1972.
Darin gibt es verbotene Zonen, die möglicherweise von Aliens besucht wurden. Die Menschen müssen sich mit dem Gedanken abfinden, dass die Aliens nichts Interessantes auf der Erde gefunden haben und wieder gingen.
Nur die besten Wissenschaftler dürfen diese Zonen betreten. Es gibt aber auch die „Stalker“ – Personen, die die Zonen ohne Erlaubnis betreten. Doch die Zonen verändern sie. Ihr Verständnis der Welt und ihr Menschsein sind danach nicht mehr wie vorher.
Für mich… ist „Picknick am Wegesrand“ eine Geschichte über Inklusion. Sie stellt die Frage: Was bedeutet es, in einer Welt zu leben, die durch Grenzen definiert ist, die wir nicht überschreiten sollen?
Am Anfang des Buches erklärt ein Wissenschaftler seine Theorie über die Aliens mit der Metapher eines
Picknicks…
Roadside Picnic:
Nunnan zuckte zusammen. „Was sagten Sie da?“
„Ein Picknick. Stellen Sie sich einen Wald vor, einen kleinen Pfad, eine Wiese. Vom Pfad biegt ein Auto zur Wiese ab, ein paar Burschen und junge Mädchen steigen aus, beladen mit Flaschen, Proviant, Kofferradios, Fotoapparaten... Sie zünden ein Lagerfeuer an, bauen Zelte auf, spielen Musik. Am nächsten Morgen dann fahren sie wieder ab. Die Tiere, Vögel und Insekten, die voller Furcht das nächtliche Treiben beobachteten, wagen sich aus ihren Verstecken hervor. Was aber entdecken sie? Auf der Wiese stehen Lachen von Kühlwasser und Benzin, kaputte Zündkerzen, und ausgewechselte Ölfilter liegen herum. Alles mögliche Zeug ist verstreut — durchgebrannte Glühbirnen, ein Zündschlüssel, den jemand verloren hat. Die Autoreifen haben Schlammreste hinterlassen, die von irgendeinem Sumpfgebiet stammen. Nun ja, und dann natürlich die Überreste des Lagerfeuers, abgeknabberte Apfelgriebse, Bonbonpapier, Konservendosen, leere Flaschen, ein Taschentuch vielleicht und ein Federmesser, Fetzen von Zeitungspapier, Geldmünzen, verwelkte Blumen, die auf anderen Wiesen gepflückt wurden...“
„Ich hab’ verstanden“, sagte Nunnan, „ein Picknick am Wegesrand gewissermaßen.“
„So ist es. Ein Picknick am Rande eines kosmischen Weges. Sie aber fragen mich, ob diese Fremden zurückkommen oder nicht.“
MARIANNE:
Das erinnert mich an Benjamin, der in „Erfahrung und Armut“ über eine Generation schrieb, die von der Fahrt mit dem Pferdewagen oder Schlitten zur Schule plötzlich mit der modernsten Technologie konfrontiert wurde. Und so war es auch bei mir!
In den 50er Jahren spielten wir auf der Straße, weil es kaum Autos gab. Wir spielten Spiele wie „Meister, Meister, gib uns Arbeit“ über die Straße, wobei ein Kind uns von der anderen Straßenseite aus rief.
Niemand hat uns gesagt, dass wir von der Straße runter müssen, weil es völlig sicher war.
CARO:
Das hat sich jetzt bestimmt geändert.
MARIANNE:
Ich erinnere mich auch daran, dass das Sammeln von Glasflaschen eine beliebte Aktivität war. Manchmal war es sogar vorgeschrieben. Recycling, oder „Zero Waste“, wie wir es heute nennen würden, war in der DDR von Anfang an ein großes Thema.
Für jede Flasche oder jedes Glas bekamen wir ein paar Pfennige. Manchmal mussten wir es für die Pioniere tun. Ansonsten sind wir einfach mit einem kleinen Handwagen von Tür zu Tür gegangen und haben gefragt: „Flaschen, Gläser oder Altpapier?“ Und die Leute sagten: „Ja, schaut mal unten nach!“ Und so haben wir alles gesammelt, und das war unser Taschengeld.
CARO:
Wo konntet ihr sie hinbringen?
MARIANNE:
Oh, zu einer Sammelstelle. Es gab eine direkt neben der Schule. Ich weiß nicht, wann sie die abgeschafft haben, wahrscheinlich, als die gelben Säcke eingeführt wurden. Wir konnten das bis zum Alter von 14 Jahren machen, würde ich sagen. Man brauchte keine Erlaubnis.
CARO:
Erlaubnis? Hmm... und was ist mit der russischen Präsenz? Es muss... ich meine... haben Sie sie bemerkt? Waren sie in der Nähe?
MARIANNE:
Ja, natürlich. Es gab ein ziemlich großes Gebiet, das abgezäunt war. Das Sperrgebiet.
CARO:
Dort lebten die Russen?
MARIANNE:
Dort wohnten hauptsächlich die höheren sowjetischen Beamten und ihre Familien, ja. Es gab auch die Kasernen.
CARO:
Wo war die „Zone“?
MARIANNE:
Sie veränderte sich ständig. Alle paar Jahre schrumpfte sie. Aber als ich ein Kind war, erinnere ich mich, dass der Zaun entlang der Treskowallee verlief.
CARO:
War es nicht seltsam, diese Bereiche zu haben, in die man nicht gehen konnte?
MARIANNE:
Nicht wirklich.
CARO:
Es scheint einfach so falsch zu sein, dass Menschen nicht in der Lage sind, an einen Ort zu gelangen, an dem sie vorher vielleicht sogar einmal gelebt haben.
MARIANNE:
So war es damals. Aber ich kannte es nicht anders. Es erscheint nur jetzt seltsam. Das war meine Welt. Es gab Orte, an die man nicht kam.
CARO:
Hmm... wie hast du dich gegenüber den Russen gefühlt?
MARIANNE:
Nun, meine Eltern, deine Urgroßeltern, waren eher links orientiert. Ich habe es also nicht wirklich als negativ empfunden. Es mag sehr wohl eine Menge Ressentiments und Feindseligkeit gegeben haben. Aber ich weiß mit Sicherheit, dass die Soldaten den Menschen leid taten. Es sickerte bis zu uns durch, wie schlecht die einfachen Soldaten behandelt wurden. Einige versuchten sogar ab und zu zu fliehen. Aber wenn sie erwischt wurden - das war wirklich lebensgefährlich, oder sie landeten in einem Militärgefängnis. Offenbar waren sie in den Kasernen schlecht versorgt und hatten nicht genug Kleidung. Die Leute hatten wirklich Mitleid mit ihnen. Es waren junge Männer, die nur einen Tag im Monat frei bekamen. Und selbst an diesem Tag durften sie nicht spazieren gehen, sondern mussten an Gruppenausflügen teilnehmen, wie zum Beispiel in den Zoo. Ich meine, ich bin sicher, das war genau das, was junge Männer am meisten interessierte (lacht ironisch).
Die einfachen Soldaten durften also nicht frei in Karlshorst herumlaufen. Aber die Familien schon.
CARO:
Es ist seltsam, dass du so mitfühlend über sie sprichst.
MARIANNE:
Es waren einfach Menschen.
CARO:
Natürlich, aber das ist eine ziemlich vereinfachte Sichtweise, Oma. Schließlich gab es hier eine große KGB-Basis, so dass Karlshorst besonders intensiv überwacht wurde.
MARIANNE:
Ja das stimmt, aber daran kann ich mich nicht erinnern.
CARO:
Gab es denn Spannungen zwischen den Deutschen und den Russen? Ich dachte, dass die Russen bei Dingen, die nur in begrenztem Umfang vorhanden waren, bevorzugt wurden. Sicherlich muss es da Spannungen gegeben haben. Eine Frustration darüber, dass sie Dinge vor den Deutschen bekamen. In Deutschland…
MARIANNE:
Das ist nicht unbedingt wahr. Sie bekamen nicht immer alles zuerst. Es war eine komplizierte Zeit und die Versorgung änderte sich für alle drastisch. Ich erinnere mich noch daran, dass sie Zeitungen an die Fenster klebten, anstatt Gardinen. Kannst du dir das vorstellen? Ich weiß nicht, ob es unser Neues Deutschland oder die Prawda war, aber sie klebten sie an die Fensterscheiben. Man konnte nicht hineinsehen. Und man konnte auch nicht hinaussehen! Es muss also offensichtlich sehr kompliziert für sie gewesen sein, Gardinen zu bekommen.
CARO:
In dem Artikel, über den ich neulich sprach, wurden diese russischen Häuser erwähnt, die seit dem Abzug leer stehen. Kennst du die?
MARIANNE:
Ja. Sie lagen im militärischen Sperrgebiet.
CARO:
Sie stehen wirklich schon eine sehr lange Zeit leer. Ich kann nicht glauben, dass noch niemand dort eingezogen ist.
MARIANNE:
Na ja, sie gehören immer noch Russland.
CARO:
Vielleicht haben sie noch Zeitungen an den Fenstern... sollen wir sie uns ansehen?
MARIANNE:
Ich zeige dir auf dem Weg, wo das Sperrgebiet war…
Ort