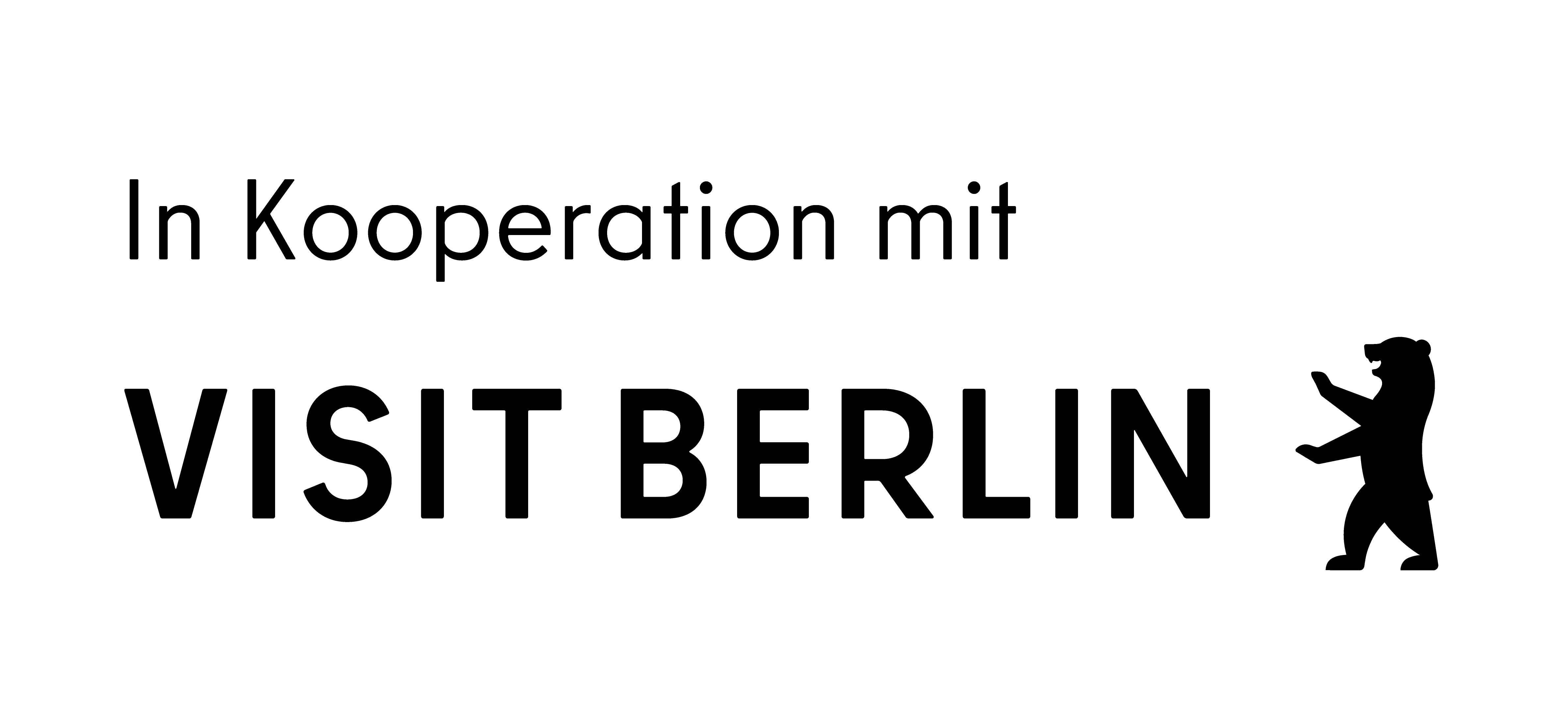Audiowalk "and let no one be forgotten"

Foto: Katya Romanova
Rheinsteinpark
Interviews
Der Weg zur Andernacherstraße/Königswinterstraße
Auf dem Weg zum Tourstop Andernacher Straße / Königswinterstraße können wir uns ein paar Interviews zwischen Jeremy Knowles und Wolfgang Schneider sowie Marianne Streisand anhören.
Interviews
Ort: Der Weg zur Andernacher Straße/Königswinterstraße
Roadside Picnic:
Der Bürgersteig kam immer näher, und schon fiel der Schatten unseres Fahrzeugs auf das schwarze Gestrüpp... Schluß mit der Sicherheit, wir waren in der Zone! Augenblicklich spürte ich, wie es mich kalt überrieselte... Das mit den Schauern passierte mir jedesmal, und bis jetzt weiß ich nicht, ob es die Zone selbst ist, die mich auf diese Weise begrüßt, oder ob einfach die Nerven verrückt spielen. Jedesmal nehme ich mir vor: Wenn du zurück bist, fragst du, ob’s den anderen auch so geht, doch ich vergesse es immer wieder.
Jeremy Knowles:
Darf ich dich begleiten? Wir laufen die Rheinsteinstraße entlang und gehen dann nach rechts in den Park.
Wolfgang Schneider:
Die Zugänge zum Sperrgebiet befanden sich also vorne an der Rheinsteinstraße, Ecke Ehrenfelsstraße, das war der Haupteingang. Mit der Verkleinerung des Sperrgebiets, also ursprünglich, zwischen 1945 und 1949, da war der Zugang direkt unter der S-Bahn-Brücke. Das war also ideal als Zugang, weil da brauchten sie nicht viel absperren. Dort war der Schlagbaum. 1947 ist der dann zurückgelegt worden in Höhe der Dönhoffstraße. Also das war die erste. Und dann, nach 1949, zurückgelegt in die Rheinsteinstraße, Ecke Ehrenfelsstraße.
Also mein Name ist Wolfgang Schneider. Ich bin von Beruf Lehrer, wohne seit 1957 in Karlshorst. Und als ich im Jahr 2015 berentet wurde, habe ich mir überlegt, was machst du jetzt eigentlich in deiner Rentenzeit? Und da habe ich mich den Geschichtsfreunden Karlshorst angeschlossen. Und seit 2015 beschäftige ich mich intensiv mit der Geschichte von Karlshorst.
Also nochmal 1945, es sind rund 1000 Häuser hier in Karlshorst requiriert worden von der sowjetischen Besatzungsmacht. 1000.
Und weil hier die Kapitulation stattfinden sollte, also die offizielle Begegnung, deshalb mussten die Karlshorster am 5. Mai alle Karlshorst verlassen. Karlshorst wurde also mit Megafon und mit Aushängen.
Der Pfarrer hat, weil die Leute hatten ja alle Angst, was passiert denn jetzt, wenn die Russen kommen. Hatten ja alle eine Riesenangst. Dann sind sie in die Kirche gegangen, haben zusammengehockt und dann kam der Pfarrer und hat erzählt, also wir müssen alle raus. Innerhalb von zwölf Stunden, Karlshorst wurde geräumt. Und mitnehmen durften sie nur das, was sie mit den Händen tragen konnten. Ihre ganzen Möbel mussten sie drin lassen, ihre Einrichtungsgegenstände und und und. Jetzt könnt ihr sagen, oh schrecklich. Aber das war eigentlich für das Kriegsende normal. Und Karlshorst hat dafür kein Alleinstellungsmerkmal. In den westlichen Besatzungszonen bzw. in den westlichen Besatzungssektoren von Berlin passierte das Gleiche.
Jeremy Knowles:
Wenn du bereits im Park bist - geh hinein und nimm den Weg durch die Mitte. Vorbei an der Statue auf der linken Seite und den Tischtennisplatten auf der rechten Seite.
Marianne Streisand:
Ach, ich liebe Karlshorst. Ich liebe Karlshorst. Und wir hatten mal mit Freunden aus dem Westen so eine Diskussion, was ist eigentlich Heimat für uns? Und da habe ich gesagt, also wenn ich irgendwie sowas wie Heimatgefühle habe, dann habe ich die noch für Karlshorst.
Also mein Name ist Marianne Streisand und meine Verbindung mit Karlshorst ist, dass ich da das erste Viertel meines Lebens verbracht habe. Eben von der Geburt bis zum 26. Lebensjahr habe ich in der Gundelfinger Straße gewohnt. Bin dort zur Schule gegangen und so weiter. Auch noch im Studium habe ich da gewohnt.
Also das Sperrgebiet gehörte bei uns sozusagen zum Alltag. Das gab es eben. Es ging immer weiter zurück in den verschiedenen Jahren.
Der Polizist hatte, stand dann da an der offenen Tür immer. Und ich glaube, die hatten da auch irgend so ein Wachhaus oder so, Wachhäusche. Und da stand der, also ich kann mich nicht erinnern, dass die die irgendwie aufgeschlossen hätten, die war offen. Aber es wurde jeder gefragt, der da reinging, nach dem Passierschein, bzw. der lächelte und ließ uns dann durchgehen.
Was ja auch bekannt ist, ist, dass eben die Soldaten, die taten uns wirklich leid, die waren ja nicht im Sperrgebiet, sondern in der Kaserne hinter der Trabrennbahn irgendwo, kaserniert und da, die mussten wirklich, also ganz, wirklich schlimm, also nicht genug zu essen und ganz ärmlich, also die haben nicht mal Unterhosen.
Wolfgang Schneider:
Ihr müsst euch vorstellen, also versetzt euch mal in einen Deutschen rein, der 1945, 1946 hier sein Haus hatte. Versucht das bloß mal nachzuempfinden. Du hattest, du warst eine Frau, das war dein Haus, das dein Mann für dich gebaut hat. Das war deine Lebensversicherung, deine Einkunft, vielleicht hast du Miete bekommen und und und. Und das war plötzlich weg. Du hattest nichts mehr außer deinem Leben. Und da gab es zum Beispiel die Familie Agaschewski. Herr Agaschewski war ein Architekt. Der hatte hier in Karlshorst ganze Häuser, Zeilen gebaut. Die waren sein Eigentum und hatte nach seinem Tod wurde das Erbe aufgeteilt. Und da hatte eben seine Frau hatte einen Großteil der Häuser bekommen. Die war damals 75 Jahre alt. Jetzt haben die Sowjets ihr Haus requeriert. Sie musste raus und sie hatte nichts. Da gab es nicht, dass du zum Bürgeramt gehen konntest und Bürgergeld beantragen konntest und Wohngeld. Nee, es gab es nicht 1945. Du hattest nichts. Und es war auch keine Aussicht. Wann sind denn die Russen wieder weg? In einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren, dann bin ich ja schon tot.
Also, 1946, hat die Frau Agaschewski, die hat die Häuser damals verkauft. Also die hat nicht gewartet, bis sie in Volkseigentum überführt wurden oder sonst irgendwas, sondern die hat schon 1946 gesagt, also ich nehme jetzt das Angebot an, ich verkaufe meine Häuser. Ich weiß nicht, wann die Russen hier
wegziehen. Wenn die weg sind und mir mein Eigentum zurückgeben. Sondern ich nehme das jetzt und habe wenigstens noch ein bisschen Geld, damit ich leben kann. Das ist die Geschichte von den bewussten Häusern in der Königswinterstraße und Andernacherstraße.
Also ich kann euch nicht sagen, welcher sowjetische Offizier in welchem Haus gewohnt hat. Ich kann nur sagen, ja, es waren sowjetische Offiziere, die hier drin gewohnt haben. Eventuell kann ich dann noch differenzieren. Ja, das war ein Mitarbeiter vom KGB. Das war ein Mitarbeiter vom GRU. Das war ein Mitarbeiter vom Militär, also ein Offizier. Oder es war der sowjetische Arzt oder die sowjetische Lehrerin, die hier an der Schule gearbeitet hat. So weit differenzieren können wir, aber nicht namentlich festhalten.
Jeremy Knowles:
Wenn du aus dem Park auf die Andernacherstraße kommst, gehe nach rechts. Du wirst bald die leeren Häuser sehen. Wenn du dort ankommst, suche dir einen Platz, wo du einen guten Blick auf sie hast.
Ort