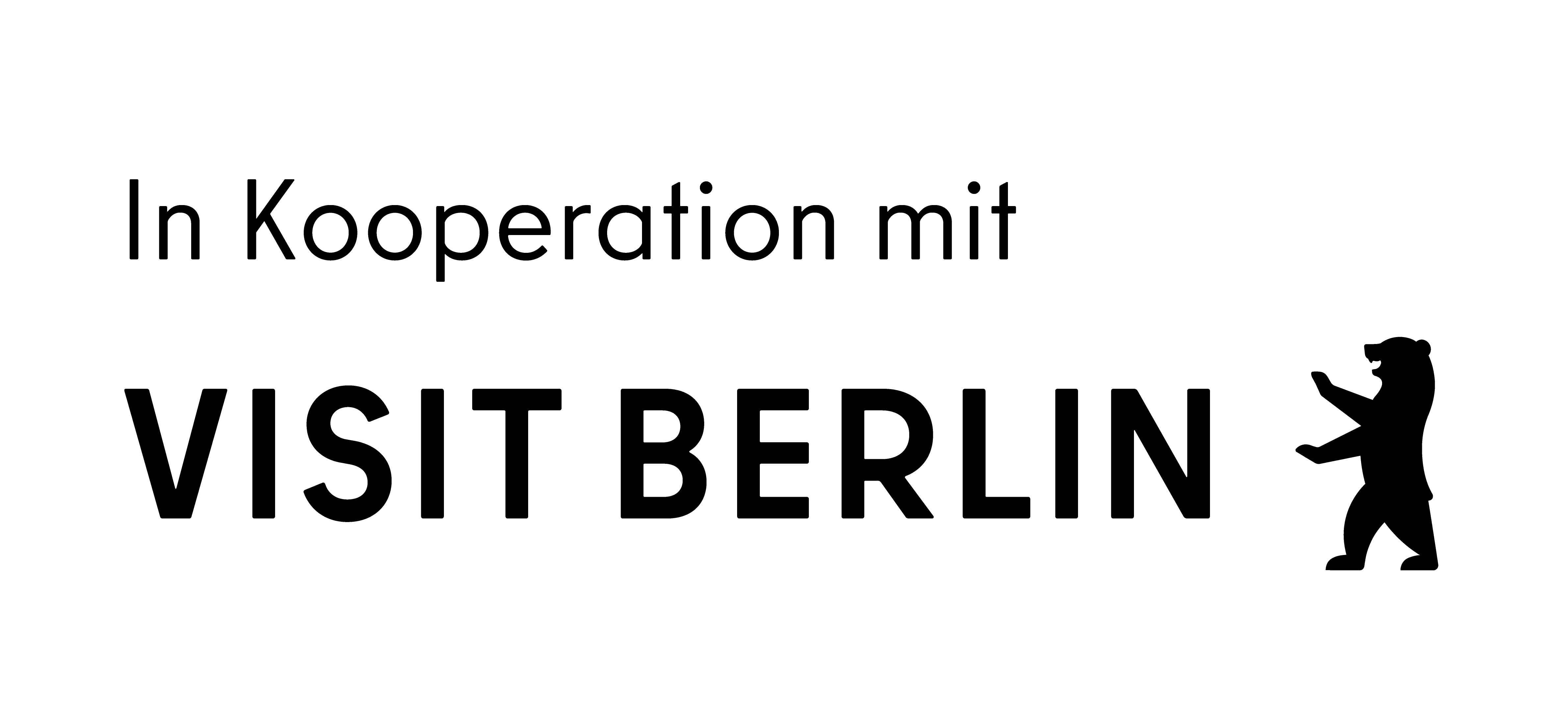Audiowalk "and let no one be forgotten"

Foto: Katya Romanova
Königswinterstr. x Andernacher Str.
Einbruch
Andernacherstraße/Königswinterstraße
Recherche + Interviews
Andernacherstraße/Königswinterstraße
und
Der Weg zur Ehrenfelsstraße/Loreleystraße
An diesem Tourpunkt geht es weiter mit den Gesprächen zwischen Caro und Marianne sowie Interviews mit Hannah, Marianne Streisand und Wolfgang Voigtländer.
Einbruch
Ort: Andernacherstraße/Königswinterstraße
CARO:
Ich glaube, das sind sie - die Häuser.
MARIANNE:
Sie sind kleiner als in meiner Erinnerung.
CARO:
Die Mülltonnen sind voller Äste. Siehst du? Bedeutet das, dass sich jemand um die Häuser kümmert?
MARIANNE:
Nun, einige der Fenster scheinen frisch vernagelt zu sein, also nehme ich an, dass sich jemand darum kümmert.
CARO:
Sieh dir die abblätternde Farbe an. Da drüben an den Balkonen. Das erinnert mich irgendwie an abblätternde Asche.
Sie sind wunderschön.
MARIANNE:
Schön?
CARO:
Ich weiß nicht so recht. Irgendwie schon. Sie fühlen sich so lebendig an mit ihrer Vergangenheit. Ich
frage mich, welche Geschichten sie in sich tragen…
MARIANNE:
Geschichten, ja. Aber es sind eher Erinnerungen, die in den Mauern gefangen sind.
CARO:
Glaubst du, dass sich noch jemand für sie interessiert?
MARIANNE:
Sie wirken sehr weltfremd, nicht wahr? Sie stecken in der Zeit fest.
CARO:
(nachdenklich) Wie heißt es so schön? „Die Vergangenheit ist niemals tot; sie ist nicht einmal vergangen.“
(Sie halten inne und lassen die Szene auf sich wirken.)
MARIANNE:
Lass uns reingehen.
CARO:
WAS?
MARIANNE:
Komm schon.
CARO:
Oma, nein.
MARIANNE:
Warum nicht? Ich kenne diese Häuser. Ich will sie von innen sehen.
CARO:
Das ist illegal.
MARIANNE:
Was passiert, wenn sie uns erwischen, hm? Die werden doch keine alte Frau bestrafen.
CARO:
So alt bist du nicht. Und so funktioniert das Gesetz nicht.
(Das Geräusch von Marianna, die näher kommt oder vielleicht am Zaun rüttelt)
Oma!
MARIANNE:
Jetzt komm schon.
CARO:
(Gibt einen resignierten Seufzer von sich) Wie sollen wir denn da reinkommen?
Wir könnten über den Zaun klettern. Die Bretter sind nur aus Spanplatten. Es braucht nicht viel, um sie zu zerbrechen.
MARIANNE:
Mit meiner Hüfte kann ich da nicht rüberklettern, sieh mich an!
CARO:
Und wie kommen wir da wohl rein?
MARIANNE:
Lass uns hintenrum gehen.
CARO:
Okay.
MARIANNE:
Ich komme mir vor wie ein ungezogenes Kind! (lacht)
CARO:
Das bist du auch! Ich kann nicht glauben, dass wir das tun. Ich sage Mama, dass das deine Idee war, falls wir erwischt werden.
MARIANNE:
Da ist ein Schloss.
CARO:
Ja, ein ziemlich armseliges. Wir müssen nur diesen Teil der Tür aufbrechen.
MARIANNE:
Nimm den Stein da.
CARO:
Alles klar.
(Geräusche, wenn sie die Tür aufbrechen.)
CARO:
Oh Gott, ich weiß nicht, ob es sicher ist, diese Treppe hochzugehen.
MARIANNE:
Komm schon, lass uns wenigstens in den ersten Stock gehen.
CARO:
In welcher Wohnung wohnte dein ‘'russischer Liebhaber'?
MARIANNE:
Ich glaube, es war die rechte. (Sie steigen die Treppe hinauf.) Hier! Das ist sie.
CARO:
Das ist eigentlich eine sehr schöne Wohnung (beeindruckt). Viel schöner als meine.
MARIANNE:
Das war das Wohnzimmer, glaube ich.
CARO:
Ich fühle mich wie auf einer Zeitreise.
(Geräusche von ihnen, die durch den Raum gehen)
MARIANNE:
Dort drüben war sein Schlafzimmer. Er teilte es mit seinem kleinen Bruder.
CARO:
Können wir rüber gehen?
MARIANNE:
Die Dielen dort sehen nicht so aus, als würden sie viel Gewicht tragen können.
CARO:
Ja, das Loch im Boden sagt mir 'nein danke'.
MARIANNE:
Mein jüngeres Ich hätte nie geglaubt, dass sich dieser Raum einmal so entwickeln würde.
CARO:
Pass auf die Kacke da auf.
Was glaubst du, was das für ein Tier war?
MARIANNE:
Wahrscheinlich Waschbären.
CARO:
Sieh dir diesen schönen alten Ofen an.
MARIANNE:
Wir hatten genau so einen.
(Geräusche, wenn sie herumlaufen.)
MARIANNE:
Es ist so... kahl.
CARO:
Was haben seine Eltern gemacht?
MARIANNE:
Ich weiß es nicht. Sein Vater war eine Art hochrangiger Soldat. Wir haben uns nicht wirklich mit unseren Eltern oder der Politik oder so beschäftigt. Und es gab eine Sprachbarriere. Wir mochten einfach unsere Gesichter.
CARO:
So eitel. (lacht)
MARIANNE:
Ich erinnere mich, dass er mir einmal dieses Album zeigte - ein wunderschönes Buch, das sein Vater über seine militärische Laufbahn gemacht hatte. Es enthielt Bilder von ihm in Uniform, die mit ausgeschnittenen Papierblumen verziert waren, und Illustrationen, die er gezeichnet hatte. Es schien eine seltsam künstlerische Tradition für einen Soldaten zu sein.
CARO:
Oh, ich kann mir vorstellen, wie ihr beide hier sitzt und euch ineinander verliebt. Gemeinsam Pläne schmieden. Habt ihr von der Zukunft geträumt?
MARIANNE:
Ich weiß es nicht. Wir müssen es getan haben. Ich glaube, wir haben Witze darüber gemacht, zusammen wegzulaufen, aber es war nie ernst. Wir haben es nicht wirklich so gemeint.
CARO:
Gab es Dinge, die du in deinem eigenen Leben tun wolltest?
MARIANNE:
Ich erinnere mich, dass ich unbedingt reisen wollte und das Gefühl hatte, dass das nicht möglich war. Ich sehnte mich nach Freiheit. Die Freiheit zu reisen. Man konnte nicht einmal in die Sowjetunion reisen, außer in seltenen Fällen.
Der Mangel an Reisen war wirklich etwas, das an mir genagt hat. Und dieses Gefühl, gefangen zu sein. Ich fühlte mich gefangen. CARO:
(leise) Wie hat es geendet? War es ein tragischer Liebeskummer?
MARIANNE:
Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, der Reiz des Neuen hat nachgelassen. Oder vielleicht wurde es auch immer schwieriger, sich zu sehen.
CARO:
Oh, Sacha Kazakov. Wo bist du jetzt?
MARIANNE:
Sehr weit weg von hier.
CARO:
Dieses Haus ist wirklich sehr schön. Ich wünschte, ich wäre reich und könnte es einfach kaufen und alles renovieren. Stell dir vor, ich würde es wieder zum Leben erwecken! Im Moment ist es einfach nur... leer. Es ist so falsch! Es fühlt sich fast an, als würde es trauern. Es ist eine Art Kummer in diesem Raum.
Es fühlt sich ein bisschen wie ein Friedhof an, nicht wahr? Es spukt nicht unbedingt. Nur... tot.
MARIANNE:
Ich will jetzt gehen.
CARO:
Was?
MARIANNE:
Lass uns gehen. Hier gibt es nichts außer vergessenen Erinnerungen und Waschbärpisse.
Roadside Picnic:
„Hören Sie, Doktor Pillman“, sagte Nunnan und säbelte ein Stück Fleisch ab, „was meinen Sie, wie das Ganze noch enden wird?“
„Wovon sprechen Sie?“
„Na, vom Besuch, der Zone, den Schatzgräbern, dieser ganzen Kriegsindustrie und so weiter... Wie das ausgeht... Mich würde Ihre Ansicht interessieren.“
Pillman musterte ihn lange hinter seinen undurchdringbar dunklen Brillengläsern hervor. Dann steckte er sich eine Zigarette an und sagte: „Für wen, ist hier die Frage. Da müßten Sie sich schon ein bißchen konkreter ausdrücken.“ „Nun, sagen wir mal, für unseren Teil des Planeten.“
„Das hängt davon ab, ob wir Glück haben werden oder nicht“, erwiderte der Gelehrte. „Wir wissen jetzt
ziemlich sicher, daß für unseren Teil des Planeten der Besuch so gut wie ohne Folgen verlaufen ist. Natürlich ist es, wenn wir weiterhin blindlings die Rosinen aus dem Kuchen picken, nicht ausgeschlossen, daß wir eines Tages Dinge zutage fördern, die das Leben nicht nur bei uns hier, sondern auf dem gesamten Planeten unmöglich machen. In diesem Falle hätten wir Pech gehabt. Aber Sie müssen zugeben, daß eine solche Gefahr der Menschheit schon seit eh und je gedroht hat.“
Recherche + Interviews
Ort: Andernacherstraße/Königswinterstraße
Der Weg zur Ehrenfelsstraße/Loreleystraße
Hannah:
Was Ihr hört, ist eine Aufnahme von einem unserer Forschungstage im Juni, aufgenommen hier an der Ecke Andernacherstraße und Königswinterstraße.
Mein Name ist Hannah Alongi, und ich bin eine der mitwirkenden Künstlerinnen bei diesem Audiowalk.
Im Sommer haben wir hier auf dem Bürgersteig einen mobilen Kiosk aufgestellt – ein öffentliches Forum, das wir den Kiosk of Memory nannten – und Passanten eingeladen, ihre Gedanken und ihr Wissen über die Häuser mit uns zu teilen. Wir boten auch ein Programm mit Vorträgen und einen Rundgang durch das Viertel an, geleitet von lokalen ExpertInnen, um historische Einblicke in die Häuser zu vermitteln und einen Raum für den Austausch zwischen Nachbarn zu schaffen.
Durch diesen Austausch begannen wir, die Häuser nicht mehr als bloße Relikte der Vergangenheit zu sehen, sondern als gegenwärtig und relevant. Die Menschen wünschen sich eine Lösung. Viele AnwohnerInnen hoffen, dass die Häuser eines Tages wieder Teil der Gemeinschaft werden; andere befürchten, dass durch eine mögliche Nutzung das Wenige, was noch übrig ist, bedroht sein könnte.
Von Anfang an hofften wir, mit einem ehemaligen BewohnerInnen sprechen zu können, der noch lebt. Da die Wohnungen jedoch von 1945 bis zu ihrer Leerstandphase von Militärangehörigen und ihren Familien bewohnt wurden, ist es unwahrscheinlich, dass wir jemals aus erster Hand vom Leben darin erfahren werden.
Ein Wendepunkt in unserer Forschung war die Entdeckung von Telefon- und Adressbüchern mit den Namen von Menschen, die einst in den Häusern lebten – natürlich aus der Zeit vor der DDR, als die Bewohner keine sowjetischen Offiziere waren, sondern einfache, überwiegend deutsche Zivilisten. Dokumente können uns keine vollständige Geschichte erzählen, aber sie geben uns Einblicke in das Leben der Menschen damals. Auch wenn wir nur ihre Namen, die Jahre, in denen sie hier lebten, und ihre Berufe kennen, können wir langsam ein Bild davon zeichnen, wer sie waren.
Für einen Namen jedoch ist keine Vorstellungskraft notwendig: Rudolf Mandrella. Seine Geschichte wurde durch umfangreiche Aufzeichnungen rekonstruiert. Hier ist einiges, was wir wissen:
Mandrella wurde 1902 in Auschwitz geboren und wuchs in Armut auf. 1923 zog er als mittelloser Student nach Berlin, um Jura zu studieren. Nachdem er seine Prüfungen bestanden hatte, wurde er
1933 zum Amtsrichter in Köpenick ernannt. Drei Jahre später zog er in eine Wohnung in der Königswinterstraße 24.
Mandrella stand dem Nazi-Regime völlig ablehnend gegenüber. Um einer Einberufung in die Wehrmacht zu entgehen, meldete er sich freiwillig zur Marine – möglicherweise in der Hoffnung, seine Chancen auf Nahkampfeinsätze gering zu halten. In Stettin, wo er stationiert war, lernte Mandrella Gleichgesinnte kennen, die ebenfalls gegen die Nazis und den Krieg waren. Doch ihre Gruppe wurde entdeckt.
Mandrella wurde am 3. September 1943 in der Strafanstalt Brandenburg-Görden hingerichtet. Sein Name ist unter den Widerstandskämpfern und Märtyrern der Nazi-Zeit auf einer Gedenktafel in der Krypta des St.-Hedwigs-Kathedrale in Berlin-Mitte verzeichnet.
Das Bild, das wir malen, wird nie vollständig sein, aber mit den Hinweisen, die uns bekannt sind, können wir derer gedenken, deren Namen einst durch diese Flure hallten.
Ich lade Euch ein, uns zu helfen, die Lücken zu füllen.
Es ist Zeit weiterzugehen. Folgt der Königswinterstraße in Richtung weg vom Park. Wenn Ihr die Ehrenfelsstraße erreicht, biegt links ab. Ihr werdet auf der rechten Seite das nächste leerstehende Haus sehen. Während wir weitergehen, lese ich Euch einige der Namen vor, die wir gefunden haben – die Namen, die uns bekannt sind...
Frieda Knippel, Sekretärin, Andernacherstraße 5a, 1943 Ernst Keppler, Kaufmann, Andernacherstraße 5a, 1943 Günther Leibig, Doktor, Königswinterstraße 24, 1935
Katharina Schmidt, Pensionär, Königswinterstraße 24, 1937 Heinrich Erdner, Gärtner, Andernacherstraße 5a, 1940
Else Siewfe, Hausfrau, Königswinterstraße 25, 1943 Erich Gromabla, Ingenieur, Andernacherstraße 5a, 1933
Rudolf Mandrella, Amtsrichter, Königswinterstraße 24, 1937
Marianne Streisand:
Mein Großvater war Jude und hatte in West-Berlin eine Buchhandlung, also ein Antiquariat, wo er sich auf wissenschaftlichen Sozialismus damals spezialisiert hatte, schon in den 20er Jahren und also ganz tolle Leute, so wie Walter Benjamin oder so, die haben bei ihm eingekauft, irre, wa?
Ja, mein Vater und meine Tante, die Kinder also von den beiden, die waren ja sogenannte Halbjuden, nach Nazi-Terminologie.
Ja, und für die war das natürlich wirklich eine Befreiung, als die Russen Berlin einnahmen, das kann man sich ja vorstellen.
Wolfgang Voigtländer:
Mein Vater hat nie über den Krieg gesprochen. Also der war Soldat und ich weiß nicht mal, ob er in Gefangenschaft war. Er war, glaube ich, irgendwie in Norwegen oder so. Aber er hat nie darüber gesprochen.
Mein Name ist Wolfgang Vogtländer, bin am 15.03.1951 in Erfurt geboren und die Brücke dann gleich zu Karlshorst, ich bin 1963 oder 1964 nach Karlshorst gezogen.
In Karlshorst habe ich in der Hentigstraße 33 gewohnt, das ist von Krümelhardt-Gundelfinger, das ist eine Straße weiter, also es war natürlich nicht einfach und zu Anfang fanden wir es nicht prickelnd, Umgebung zu verlassen, wo man Freunde hat und so, aber klar, ich war der ‘Sachsenscheißer’, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, ich kam ja aus Thüringen, Thüringen und Sachsen ist so eine Geschichte und der Dialekt ist ja gewöhnungsbedürftig und zu Anfang, man gibt sich alle Mühen, nicht Dialekt zu sprechen, und das geht natürlich voll in die Hose, naja und ein üblicher Begriff damals war
‘Sachsenscheißer’.
Sagen wir mal so, sowjetischen Soldaten hat man alleine sowieso nie gesehen. Die waren in der Kaserne oder wo auch immer, aber nicht Kontakte. Sonst ist ein Offizier mit ein, zwei, drei Soldaten unterwegs, haben was organisiert oder so.
Das ging schon. Aber das war es. Wie gesagt, also dem persönlichen Kontakt, das war nicht erwünscht.

Foto: Katya Romanova

Foto: Katya Romanova
Ort