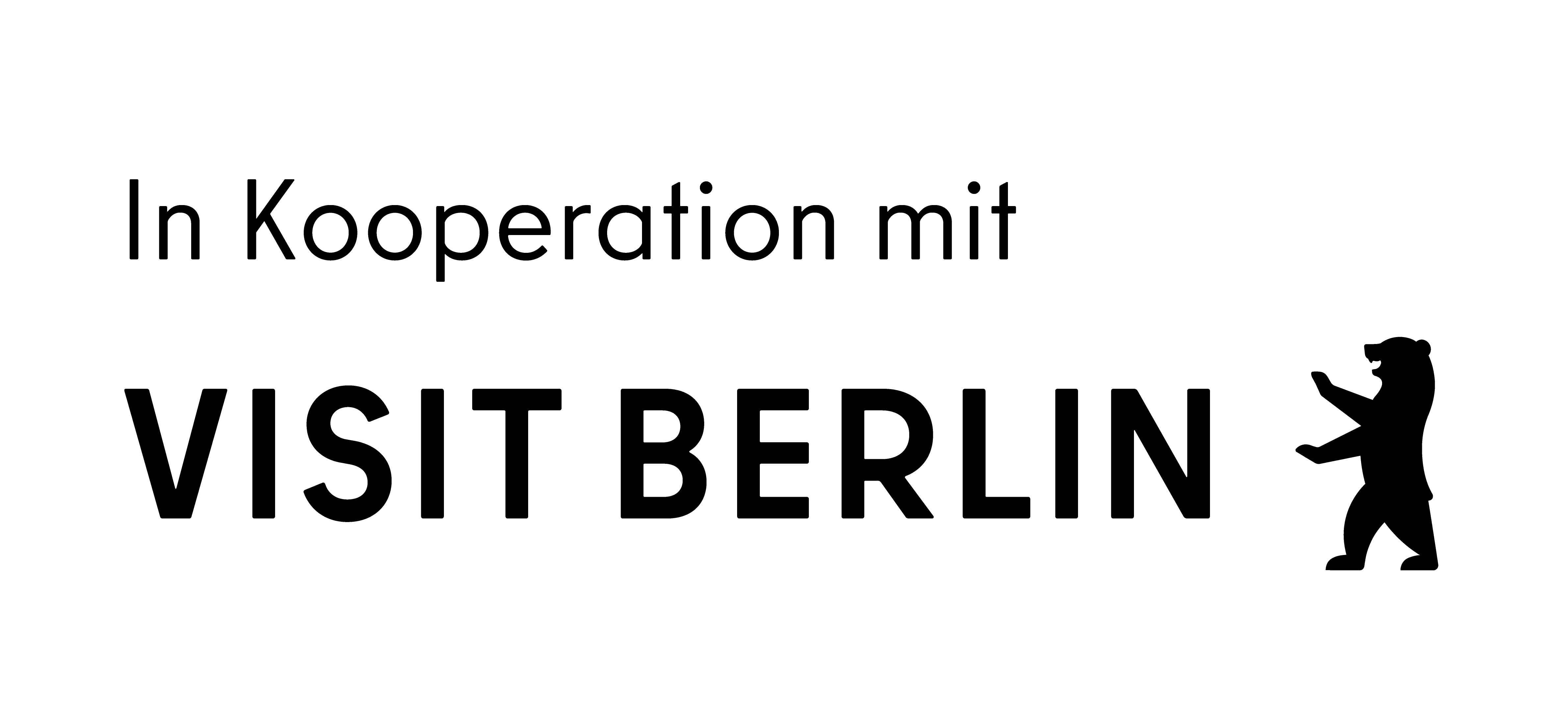Audiowalk "and let no one be forgotten"

Foto: Katya Romanova
Ehrenfelder Str. x Loreleystr.
Birken
Ehrenfelsstraße/Loreleystraße
Waschbären
Ort: Der Rückweg zur Station
An dem letzten Tourpunkt unseres audiowalks geht es um Birken und Waschbären, im Anschluss kehren wir zurück zum Startpunkt unserer Tour, der S-Bahnstation Karlshorst.
Birken
Ort: Ehrenfelsstraße/Loreleystraße
und
Waschbären
Ort: Der Rückweg zur Station
CARO:
Hier ist es.
MARIANNE:
Ja.
CARO:
Irgendwie sehen sie noch schöner aus, weil sie auseinanderfallen. Ergibt das einen Sinn?
MARIANNE:
Ich weiß es nicht. Ich finde, sie sehen traurig aus.
CARO:
Sollen wir in dieses auch einbrechen? (Sie fragt scherzhaft) (Marianne antwortet nicht.)
MARIANNE:
Sieh dir mal die Birke auf dem Balkon an.
CARO:
Das Haus befindet sich im Krieg mit der Natur.
MARIANNE:
Man kann nie wissen, vielleicht arbeiten sie ja zusammen.
CARO:
Es ist verrückt, dass diese Häuser so viel Geschichte haben. Sie waren einmal so lebendig und jetzt sind sie so... leise.
MARIANNE:
Sie sind immer noch lebendig. Für mich fühlen sie sich noch lebendig an.
CARO:
Aber ich wünschte, man könnte hier neue Erinnerungen schaffen. Damit sie weiterleben können. Es fühlt sich so an, als ob sie Geister beherbergen würden.
MARIANNE:
In gewisser Weise tun sie das auch.
CARO:
Ich frage mich, was die Zukunft bringen wird. In dem Artikel, den ich über die Häuser gelesen habe, wird ein Zahnarzt erwähnt, der versucht hat, alle zu täuschen um eine Kaufgenehmigung zu bekommen. Die russische Botschaft hat dann gesagt: „Hmm nein! Das sind unsere!'
MARIANNE:
Das klingt ungefähr richtig.
CARO:
Das ist nicht fair! Wir sollten sie einfach zurücknehmen. Ich meine, warum respektieren wir diese unklaren Eigentumsverhältnisse? Es ist ja nicht so, dass Russland uns Respekt gezeigt hätte. Sie sind hierher gekommen und haben den Menschen, die vorher hier gewohnt haben, ihre Häuser weggenommen. Warum sollten sie die Häuser jetzt behalten und sie einfach verfallen lassen?
MARIANNE:
Du weißt nicht, was du da sagst. Ich würde mich nicht einmischen wollen. Jeder aus dem Osten weiß, dass man sich von unklaren Eigentumsverhältnissen fernhalten sollte.
CARO:
Warum nehmen wir sie nicht einfach zurück? Besonders jetzt, mit dem Krieg in der Ukraine.
MARIANNE:
Ich möchte eigentlich keine plötzlichen Enteignungen, nur weil sie aufgrund der Kriegssituation in russischem Besitz sind. Das fände ich schlimmer, als die Häuser noch ein paar Jahre leer stehen zu lassen. Ich glaube nicht eine Sekunde daran, dass die russische Regierung zustimmen würde, Leute einfach dort einziehen zu lassen.
CARO:
Aber das ist doch nicht richtig! Es gibt so viele Menschen hier in Berlin, die ein Zuhause brauchen.
MARIANNE:
Ich würde es vorziehen, wenn alles friedlich gelöst wird, wenn möglich. Alles andere macht mir furchtbare Angst. Macht es dir nicht auch Angst?
CARO:
Nein, es macht mich nur wütend.
MARIANNE:
Wut ist ein jugendliches Gefühl. Aber ich habe Angst, Staub aufzuwirbeln. Die ganze Welt scheint mir jetzt so beängstigend zu sein. Ich weiß nicht. Vielleicht erinnere ich mich nicht richtig, und die Angst war größer, als ich sie in Erinnerung habe. Aber ich fühle mich jetzt noch ängstlicher als früher.
CARO:
Du erinnerst dich nicht an Angst?
MARIANNE:
Ich erinnere mich, dass die Generation meiner Eltern von Angst sprach. Man darf nicht vergessen, dass ich nach dem Krieg geboren wurde. Ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, in der die Russen sozusagen unsere „Feinde“ waren. Für mich waren sie einfach 'andere'.
Was bedeutet Feind überhaupt? Das ist ein triviales Konzept. Der Feind ändert sich von einem Tag auf den anderen, sobald ein neuer politischer Wind weht.
CARO:
Wie meinst du das?
MARIANNE:
Ich erinnere mich, dass mein Vater mir gleich nach dem Krieg erzählte, dass es Nachbarn gab, die sie seit Jahren kannten und die plötzlich behaupteten, sie seien schon immer Kommunisten gewesen.
Manchmal gaben sie sogar vor, Opfer des Faschismus zu sein. Meine Eltern waren sprachlos darüber. Wie schnell sie aus Feinden Freunde machten. Diese Leute blähten sich auf, fingen an zu protzen und erlangten schnell kleine Machtpositionen. Plötzlich gab es Haus- oder Straßenvorsteher, die ihr Gebiet zu überwachen hatten. Sie mischten sich in alles ein und erstatteten den neu eingerichteten Polizeistationen oder den russischen Kommandostellen Bericht.
CARO:
Siehst du, genau daran denke ich, wenn ich an den Osten und die Russen denke.
MARIANNE:
Ja.
CARO:
Du erinnerst dich nicht an solche Dinge?
MARIANNE:
Ich erinnere mich, dass man mir solche Dinge erzählt hat. Ich glaube nicht, dass ich es selbst gesehen habe. Sogar die Geschichten, wie die Russen in diese Häuser kamen. Sie brachen die Türen auf; die Leute
dachten, sie würden erschossen werden, aber die Russen riefen in gebrochenem Deutsch: 'Raus, morgen' - und zeigten auf die 12 auf ihren Uhren. Und das war's. Sie mussten ihre Häuser verlassen.
CARO:
Das ist ja furchtbar.
MARIANNE:
Aber sie haben auch nur Befehle befolgt.
CARO:
Ja, und irgendwann, glaube ich... Ich glaube, das ist ihnen auch mit dem Abzug passiert. Sie mussten
auch gehen. Ohne große Vorwarnung. Einfach auf und los. → maybe check if there is a different version
MARIANNE:
(seufzend) Diese Gebäude hatten schon so viele Besitzer.
CARO:
Ja, aber sie zu besitzen scheint nicht viel zu bedeuten, oder?
MARIANNE:
Ich schätze, die Häuser gehören jetzt den Waschbären...
CARO:
Was denkst du, wie sie reinkommen?
MARIANNE:
Vielleicht über die Dächer? Oder sie klettern auf die Bäume und springen auf die Balkone? Ehrlich gesagt gibt es so viele Möglichkeiten für sie, hineinzukommen. Wege, die wir nicht einmal sehen können.
CARO:
Wahrscheinlich feiern sie da drinnen Raves. Sie hören ein bisschen Techno. Haben das DJ-Deck draußen. Lasershow an. Sie werfen eine Pille ein und tanzen ein bisschen.
(Sie versucht, die Stimmung für ihre Großmutter aufzuhellen, die ziemlich melancholisch wirkt.)
Oder sie führen heftige politische Debatten darüber, wem welches Zimmer zusteht. Glaubst du, dass Waschbären Hierarchien haben?
MARIANNE:
(Ohne Caro zuzuhören) Weißt du, was lustig ist? Sie haben die Freiheit, nach der ich mich gesehnt habe. Die, die uns versprochen wurde.
CARO:
Stimmt. Sie sind frei, zu kommen und zu gehen, wie es so viele Bewohner wahrscheinlich nie waren.
MARIANNE:
Seltsam, dass etwas, das nicht einmal von hier stammt, am meisten hierher zu gehören scheint. Sie benutzen sie als Unterschlupf. Die natürlichsten Bewohner der Häuser!
CARO:
Ich sage dir, es wird sehr schwer sein, sie wieder loszuwerden, falls das jemand versucht. Waschbären sind hartnäckig, oder?
MARIANNE:
Die sind harmlos.
CARO:
Da bin ich mir nicht so sicher. Hast du schon mal einen gesehen? Die frechen Dinger sehen für mich nicht so harmlos aus.
MARIANNE:
Alles erscheint harmlos, wenn man es mit Menschen vergleicht. Sie haben eine Resilienz, die ich bewundere.
CARO:
Sollen wir ihnen sagen, dass sie Unbefugte hier sind?
MARIANNE:
(Ignoriert Caro wieder)
Es ist eine Art bittersüßes Kapitel in der Geschichte dieser Häuser. Sie stehen nicht leer, sondern gehören diesen kleinen Überlebenskünstlern, die trotz aller Widrigkeiten einen Weg finden, zu gedeihen.
Ich glaube, in einem anderen Leben wäre ich gerne ein Waschbär gewesen. Die Freiheit, so herumzustreifen wie sie.
CARO:
Ich weiß nicht, was ich mit diesem Gefühl anfangen soll. Diese Häuser fühlen sich mit ihrer Vergangenheit so lebendig an, aber was sollen wir mit ihnen machen?
MARIANNE:
Wir erinnern uns an sie. Das ist, was wir diesen Orten schulden.
Katya Romanova:
Birken erinnern mich immer an Russland, wo ich aufgewachsen bin.
Wenn du in die Loreleystraße einbiegst und nach oben schaust, siehst du ein paar junge Birken, die direkt vom Balkon wachsen.
Mein Name ist Katya Romanova. Als ich nach Berlin zog, war ich neugierig, nach Spuren der sowjetischen Vergangenheit dieser Stadt zu suchen. Ich fragte mich, wie die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs hier in Deutschland wahrgenommen und gelehrt werden, im Vergleich zu Russland, wo diese Geschichte immer aus der Perspektive der Befreier*innen erzählt wird.
Die Einnahme Berlins ist in Russland bis heute ein bedeutender Moment. In Russland wird uns nahegelegt, diesen Krieg durch die Brille der Sieger und Retter zu betrachten. Dunklere Geschichten, die mit Schmerz und Verlust einhergehen, werden kaum erwähnt. Mit der Zeit hat sich der Tag des Sieges von einem Gedenktag zu einer Feier militärischer Macht entwickelt.
Mit dem Krieg in der Ukraine sehe ich eine vertraute Geschichte, die sich wiederholt – doch diesmal steht Russland auf der Seite des Aggressors und versucht dennoch, seine Handlungen als Befreiung darzustellen. An was möchten wir uns aus der Geschichte erinnern, und was vergessen wir lieber?
Genau deshalb spricht mich dieses Projekt so sehr an.
Als wir vom 20. bis 23. Juni 2024 unseren „Kiosk of Memory“ aufstellten, kamen Menschen, um ihre eigenen Erlebnisse, ihre Familiengeschichten und Sichtweisen zu teilen. Da wurde mir klar: Diese persönlichen Geschichten, alle unterschiedlich und manchmal widersprüchlich, sind die Puzzlestücke, aus denen das größere Ganze besteht.
Diese Birken hier? Sie erinnern mich an Resilienz. An Überleben. Die Birke ist stark und gedeiht unter den härtesten Bedingungen. Entlang der kargen Streifen der ehemaligen Berliner Mauer sind es die Birken, die das Vakuum schnell füllten.
Sieh dir diese hier an. Stell dir ihren Weg vor – von einem winzigen Samen, vom Wind getragen oder zufällig gelandet, der sich langsam durch die Ziegel und den Putz des Balkons kämpft. Wie alt, glaubst du, sind diese Bäume? Waren sie schon da, als die letzten Bewohner*innen dieses Haus verließen?
Machen Bäume Geräusche? Schließe die Augen und hör zu. Rascheln die Blätter? Knarren sanft die Äste? Ich habe gelesen, dass Bäume beim Wachsen niederfrequente Geräusche abgeben, die ihnen
helfen könnten, andere Bäume zu „spüren“ und mit ihnen zu kommunizieren. Da frage ich mich: Welche Geschichten erzählen diese Bäume? Was haben sie miterlebt, indem sie einfach still dastehen, während die Zeit um sie herum voranschreitet?
Wir werden jetzt zurücklaufen. Folge der Loreleystraße bis zur Stolzenfelsstraße und biege dann rechts ab. Diese Straße führt zurück zum Bahnhof.
Waschbären
Ort: Der Rückweg zur Station
Sophia Kimmig:
Wir bewegen uns in der Fläche als Menschen. Wir klettern nicht durch Bäume, wir springen nicht von Ast zu Ast, wir sind auf dem Fußboden unterwegs und deswegen bemerken wir auch oft nicht, was außerhalb dieses Horizonts passiert. Das heißt, wir schauen einfach selten nach oben und deswegen kann es ganz leicht passieren, dass an einem belebten Platz in Berlin direkt neben einer Bushaltestelle mit großem Trubel und vielen Menschen oben in der Baumkrone ein Waschbär liegt und schläft, der, wenn man hochguckt, gut sichtbar ist, aber niemand bemerkt es, weil niemand hinsieht.
Mein Name ist Dr. Sophia Kimmig. Ich bin Biologin und habe mich spezialisiert auf Ökologie und Verhalten von Wildtieren mit einem besonderen Fokus auf dem Mensch-Wildtier-Zusammenleben und Tieren in der Stadt.
In Städten gibt es viel mehr wilde, bunte, natürliche Flächen, zum Beispiel auf Friedhöfen. Dort findet man dann schöne alte Bäume, alte knorrige Eichen mit Baumhöhlen und solche Bäume mögen Waschbären besonders gerne, um in diesen Höhlen dann zum Beispiel ihre Jungtiere groß zu ziehen und sie schlafen auch gerne offen in den Ästen der Bäume.
Alte und vor allem verlassene Häuser, wie dieses hier, sind sehr beliebte Wohnorte für Waschbären in der Stadt. Waschbären können hervorragend klettern und suchen sich deswegen gerne Orte aus, die ein bisschen höher gelegen sind. In der Natur sind das alte Bäume und Höhlen in Bäumen, in denen sie ihre Jungtiere großziehen und auch schlafen können. In der Stadt bieten die Häuser sozusagen einen Ersatz dafür. Da zieht dann so ein Waschbär gerne auch mal auf dem Dachboden ein.
Waschbären sind seit den 1930er Jahren ungefähr in Deutschland. Tatsächlich kommen die Tiere eigentlich aus Nordamerika und gehören gar nicht in unsere Fauna, wurden aber aktiv hier hergebracht und ausgesetzt. Das hat auch sehr gut funktioniert. Leider, denn sie haben sich im ganzen Land ausgebreitet und eben auch die Städte besiedelt. Auch in ihrer Heimat in Nordamerika kommen Waschbären in Städten häufiger vor als auf dem Land. Sie sind sehr gut an das Leben in Städten angepasst und so haben sie eben auch in Deutschland unsere Städte erobert und auch in Berlin das Stadtgebiet für sich entdeckt.
Offiziell werden Waschbären von der Europäischen Union als invasive Arten geführt. Sie stehen auf einer Liste gebietsfremder Arten, die invasive Eigenschaften oder invasive Auswirkungen auf das Ökosystem oder die Ökosysteme in Europa haben können. Tatsächlich ist die Frage, ob der Waschbär tatsächlich invasiv ist, in der Wissenschaft hoch diskutiert. Die Waschbären-Forschenden, die es gibt, sind sich da nicht so ganz einig. Auf der einen Seite ist es definitiv so, dass der Waschbär Tiere fressen kann, Tiere erbeutet, die ohnehin schon stark bedroht sind. Das sind besonders Amphibien in Deutschland. Auf der anderen Seite sind Waschbären aber absolute Nahrungsgeneralisten. Das heißt, sie fressen sehr, sehr viele verschiedene Dinge und sie nehmen das, was sie am einfachsten bekommen, was am häufigsten vorhanden ist. Und das sind eben gerade nicht diese seltenen Arten, sondern meistens viel profanere Dinge, die häufig da sind in Städten, sind das zum Beispiel auch Abfälle, von denen wir Menschen hinterlassen. Das heißt, obwohl es eindeutig ist, dass der Waschbär einen Effekt auf Arten haben kann, ist nicht wirklich abschließend wissenschaftlich geklärt, ob dieser Effekt so groß und so relevant ist, dass er wirklich invasiv ist, dass er wirklich das Ökosystem beeinträchtigt.
Dass Waschbären sich in Deutschland so ausgebreitet haben, stellt uns auf jeden Fall vor eine ganze Menge Herausforderungen. Auf der einen Seite sind da eben Hausbesitzer, die Schäden an ihren Gebäuden befürchten und auf der anderen Seite eben Auswirkungen auf das Ökosystem, das Fressen von ohnehin schon durch den Menschen gefährdeten Arten. Gleichzeitig ist es so, dass der Waschbär jetzt mal da ist und wir gegen diese Tatsache nichts machen können. Das heißt aber nicht, dass wir das Problem nicht anerkennen können. Wir müssen schauen, wo macht der Waschbär was, welche Auswirkungen hat er auf die Menschen, auf das Ökosystem und was können wir tun, um diesen Auswirkungen entgegenzuwirken. Wo können wir vielleicht zum Beispiel Schäden kompensieren, Menschen mit Beratung unterstützen oder auch spezielle sensible Bereiche in der Natur zum Beispiel besonders vor dem Waschbären schützen.
Letztlich sind Waschbären, genau wie Menschen, hochentwickelte Säugetiere, die zu Schmerz, Leid, Emotionen fähig sind und jetzt sind sie hier. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir ein Zusammenleben ermöglichen können zwischen den Menschen, die hier sind und den Waschbären, die wir Menschen hierher gebracht haben. Ein Zusammenleben, in dem beide Seiten zurechtkommen.
Wolfgang Schneider:
Also ich kann nicht in den Kopf von Putin gucken. Ich habe nicht die Glaskugel. Ich weiß nicht, warum machen die das? Also aus Trotz, den Deutschen werden wir es zeigen, die wollen unser Gas nicht mehr, dann kriegen sie unsere Häuser nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Also die lassen es sicherlich, bevor die das verkaufen, lassen die die Häuser zusammenfallen. Und die stehen ja kurz vorm Zusammenbruch. Also ich war selber drin in den Häusern, ich habe mir das angeguckt. Die große Dachfläche ist eingestürzt, bis unten hin ins Erdgeschoss durchgebrochen. Wirklich nur der Waschbär ist drin. Da siehst du überall seine Spuren. Wenn ich Waschbär wäre, würde ich auch dort einziehen.
Also für mich waren die sowjetischen Menschen immer meine Freunde. Ich bin zum Beispiel Silvester rausgegangen, dann kam eine sowjetische Streife vorbei, die habe ich angehalten, habe Wodka ausgeschenkt. Und dann kam ein Offizier vorbei und hat erstmal den Wodka einkassiert und die Soldaten standen da und haben mich traurig angeguckt. Ich wollte eigentlich nur freundlich sein und ihnen zum neuen Jahr gratulieren. Und so habe ich gemerkt, dass da auch bei den Sowjets irgendwas nicht stimmt. Und dann habe ich gesehen, wie die sowjetischen Offiziere mit ihren Soldaten umgegangen sind. Und das hat mich aufgeregt. Die einfachen Soldaten sind wie Vieh behandelt worden hier. Und das waren hier eigentlich die Elite-Truppen, die sowjetischen. Die durften ins Ausland. Und trotzdem haben sie ihre Offiziere, also wie die mit ihren Soldaten umgegangen sind, das kann man nicht beschreiben. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, auch schon zu DDR-Zeiten. Und habe versucht Erklärungen zu finden. Ich habe aber keine gefunden.
Jeremy Knowles:
Ich finde es seltsam, dass es noch kein offizielles Denkmal oder eine Gedenkstätte für die Unabhängigkeit Ostdeutschlands von der Sowjetunion gibt.
Natürlich gibt es die Berliner Mauer, aber sie ist mehr ein Denkmal für die Teilung und Wiedervereinigung Berlins als für die Unabhängigkeit.
Viele andere ehemalige Sowjetstaaten, wie zum Beispiel Estland, Lettland, Litauen, die Ukraine oder Georgien, haben solche Denkmäler.. Aber in Deutschland gibt es keines, das das Ende der DDR und den Beginn des vereinigten Deutschlands markiert – zumindest noch nicht.
Wie könnte so ein Denkmal aussehen? Wie könnte es all das vermitteln, was wir uns wünschen? Die Häuser, in denen wir leben, tragen unsere Erinnerungen – wie Tagebücher aus Mörtel und Glas. Schau dich um. Sieh dir die Häuser der Stolzenfelsstraße mit ihren roten Dächern an.
Jedes hat seine eigene Geschichte. Aber nicht nur eine. Jedes Haus trägt viele Erinnerungen. Solche Erinnerungen zu finden ... und sie in die Gegenwart zu bringen. Ihnen eine Stimme zu geben, damit sie endlich sprechen können. Ich würde sagen, das ist die Aufgabe eines Denkmals.
Und... vielleicht ist ein Haus ja kein schlechtes Denkmal.
Roadside Picnic:
Er machte nun überhaupt keine Anstalten mehr, über etwas nachzudenken, er wiederholte nur immer, einem Gebet gleich, voller Verzweiflung: »Ich bin ein Tier, du siehst doch selbst, Kugel, daß ich ein Tier bin. Ich habe keine Worte, man hat sie mich nicht gelehrt, ich kann auch nicht denken, diese Schweinehunde haben mir keine Gelegenheit dazu gegeben. Wenn du aber tatsächlich so… so allmächtig, so allwissend bist, dann versuch es, mich zu begreifen! Wirf einen Blick in meine Seele – ich weiß genau, daß dort alles ist, was du brauchst. Es muß dort sein. Meine Seele hab’ ich niemals und niemandem verkauft! Sie ist mein geblieben, ist die Seele eines Menschen! Lies du in mir, lies, was ich wünsche, denn ich kann unmöglich etwas Schlechtes
wollen! – Der Teufel soll mich holen, aber mir fällt tatsächlich nichts anderes ein
als seine Worte: GLÜCK FÜR ALLE, UMSONST, UND NIEMAND SOLL VERGESSEN WERDEN!
(Musik: Lautarchiv of a Russian Ballad Pt. 2)
ENDE
Ort